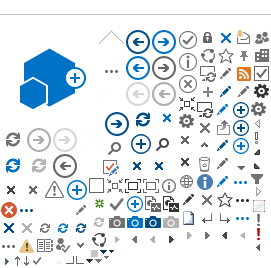PROGRID – Psychotherapeutische Behandlung der anhaltenden Trauerstörung
Projektleitung im Studienzentrum Leipzig: Prof. Dr. Anette Kersting
Principal Investigator: Prof. Dr. Rita Rosner (KU Eichstätt)
Projektmitarbeiter: M.Sc.-Psych. Julia Treml, M. Sc. Viktoria Schmidt
Kooperationspartner: Prof. Dr. Winfried Rief Studienzentrum Marburg, PD. Dr. Regina Steil Studienzentrum Frankfurt am Main, Prof. Dr. Cornelia Exner Kooperationspartnerin in Leipzig
Förderung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Laufzeit: 05/2017 – 09/2023
Die anhaltende Trauerstörung (ATS) ist als eigenständige psychische Störung anerkannt, die sich von der Majoren Depression und der posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) sowie anderen stressbedingten Störungen abgrenzen lässt. Obwohl bekannt ist, dass die ATS gesundheitliche Folgen hat, gibt es bisher nur wenig Forschung zur Behandlung.
Ziel des PROGRID-Projektes ist es, die Wirksamkeit zweier Therapieprogramme für Menschen mit ATS in einer randomisiert kontrollierten Studie miteinander zu vergleichen. Dabei handelt es sich zum einen um ein Therapieprogramm, in dem der Fokus eher auf der Trauer selbst liegt (Trauerakzentuierte Therapie), zum anderen um ein Therapieprogramm mit Fokus auf den durch die Trauer verursachten Schwierigkeiten im gegenwärtigen Alltag (Gegenwartsakzentuierte Therapie). Beide Therapieprogramme haben sich in früheren Studien als hilfreich erwiesen. Neben der Überprüfung der Effekte dieser Therapieansätze auf die ATS und mögliche komorbide Symptome (z.B. somatoforme Beschwerden, Depressivität), werden in der multizentrischen Studie auch psychologische Variablen untersucht, die mit der Trauerschwere zu Therapiebeginn zusammenhängen sowie Einflussfaktoren auf den Therapieerfolg.
Weitere Informationen
IPSA-Studie: Internettherapie bei posttraumatischem Stress nach belastenden Ereignissen im Arztberuf
Projektleitung: Prof. Dr. Anette Kersting
ProjektmitarbeiterInnen: M. Sc. Jana Reinhardt, Dr. Katja Linde
Drittmittelgeber: Roland Ernst Stiftung
Laufzeit: 03/2019 – 12/2023
Ärzt*innen sind einem erhöhten Risiko ausgesetzt, traumatische Ereignisse zu erleben. Sie sind häufig mit Schmerz, Leid oder Tod konfrontiert und auch medizinische Fehler können traumatisierend wirken. Die Prävalenz Posttraumatischer Belastungsstörungen liegt bei Ärzt*innen um ein Vielfaches höher als in der deutschen Allgemeinbevölkerung. Strukturelle, kulturelle sowie individuelle Hürden erschweren Ärzt*innen den Zugang zu Unterstützung. Da es bislang nur wenige Unterstützungsangebote für Ärzt*innen mit posttraumatischem Stress (PTS) gibt, ist die Entwicklung spezieller Behandlungskonzepte von hoher Relevanz.
Internetbasierte Interventionen können einen wichtigen Beitrag zur Versorgung von Ärzt*innen mit PTS leisten, da sie zeitlich und räumlich flexibel durchgeführt werden können und Stigmatisierungsbefürchtungen umgehen. Das Ziel der Studie ist eine Verbesserung der Versorgungssituation von Ärzt*innen mit PTS durch die Entwicklung und Evaluation einer internetbasierten Intervention, deren Wirksamkeit in einer randomisiert-kontrollierten Studie im Vergleich zu einer Wartekontrollgruppe überprüft wird.
Internetbasierte Intervention zur Reduktion von Burnout bei Altenpfleger*innen während der Covid-19 Pandemie
Projektleitung: Prof. Dr. Anette Kersting
ProjektmitarbeiterInnen: M.Sc. Martin Kramuschke, Dr. Katja Linde
Drittmittelgeber: Roland Ernst Stiftung
Laufzeit: 08/2021 – 07/2023
Altenpfleger*innen sind einem erhöhten Risiko für Burnout ausgesetzt. Eine hohe Arbeitsbelastung, irreguläre Arbeitszeitorganisation, sowie körperliche, soziale und emotionale Belastungsfaktoren führen zu erhöhtem arbeitsbezogenem Stresserleben, welches bei chronisch hoher Ausprägung das Risiko für Burnout und Folgeerkrankungen (Depression, Angststörungen, kardiovaskuläre Erkrankungen) erhöht. Präventive Ansätze können Burnout und arbeitsbezogenen Stress verhindern oder verringern und Folgeerkrankungen vorbeugen. Neben systemorientierten Ansätzen wie berufspolitischen Änderungen oder Änderungen der Arbeitsorganisation, sind auch personenorientierte Ansätze geeignet, um Stresserleben zu verringern. Ziel dieser Studie ist es, ein personenorientiertes internetbasiertes Programm zur Reduktion von Burnout bei Altenpfleger*innen zu entwickeln und in einer randomisiert kontrollierten Studie mit Wartekontrollgruppendesign zu evaluieren.
PRELOSS GRIEF, PREPAREDNESS UND PROLONGED GRIEF – PSYCHISCHES BEFINDEN VON ANGEHÖRIGEN VON MENSCHEN MIT UNHEILBAREN KREBSERKRANKUNGEN IM HOSPIZ
Projektleitung: Prof. Dr. Anette Kersting
Projektmitarbeiterinnen: Viktoria Schmidt, Dr. Julia Treml
Laufzeit: 10/2022 bis 12/2024
Das Forschungsvorhaben „Preloss Grief, Preparedness und Prolonged Grief – Psychisches Befinden von Angehörigen von Menschen mit unheilbaren Krebserkrankungen im Hospiz“ beschäftigt sich mit Trauerprozessen vor und nach einem Verlust durch eine unheilbare, tödlich verlaufende Krebserkrankung. Der bevorstehende Verlust eines Menschen mit einer terminalen Erkrankung stellt für viele Angehörige ein besonders schwer zu bewältigendes Lebensereignis dar. Angehörige sind mit der Aufgabe konfrontiert, sich auf den anstehenden Tod vorzubereiten. Starke Trauer vor einem Verlust („Preloss Grief“) kann sich dabei negativ auf die Anpassung nach dem Tod auswirken und zu einer persistierenden Trauerreaktion, auch anhaltende Trauerstörung genannt („Prolonged Grief Disorder“), führen. Dahingegen scheint ein hohes Vorbereitetsein auf den Tod („Preparedness for death“) als Schutzfaktor gegen die Ausprägung einer anhaltenden Trauerstörung zu wirken. Für die Entwicklung wirksamer Präventionsprogramme ist ein Verständnis für die Prädiktoren von Preloss Grief, Preparedness for death und Prolonged Grief notwendig. Aus diesem Grund werden in der vorliegenden Studie Korrelate von Preloss Grief und Preparedness for death und Prädiktoren von Prolonged Grief und dessen Verlauf untersucht.
TELL US – ERLEBEN VON GEWALT IN PARTNERSCHAFTEN
Projektleitung: Prof. Dr. Anette Kersting
Projektmitarbeiterinnen: M. Sc. Julia Deller, Dr. rer. nat. Julia Treml
Laufzeit: 01/2023 – 06/2024
Kooperationspartnerin: Dr. med. Julia Schellong, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus der TU Dresden
Sehr viele Menschen erleben im Laufe Ihres Lebens Gewalt in einer Partnerschaft – allein in Deutschland sind es fast die Hälfte der Personen ab einem Alter von 14 Jahren. Dabei gibt es verschiedene Formen von Gewalt wie physische oder sexuelle Gewalt, aber auch emotionale Gewalt. Diese Erlebnisse können z.B. die mentale Gesundheit beeinträchtigen und zu einem hohen Stresslevel bis hin zu traumatischem Stress führen.
Häufig leiden Betroffene zudem unter Gefühlen von Schuld, Scham oder Stigmatisierung aufgrund des Erlebten. Um psychosoziale Unterstützungsangebote zu verbessern, möchten wir die Betroffenenperspektive (u.a. aktuelles Befinden, Erfahrungen im bestehenden Hilfesystem) besser verstehen. Zu diesem Zweck führen wir eine anonymisierte Onlinebefragung durch. Teilnehmen können Personen ab 18 Jahren aller Geschlechtsidentitäten und aller sexuellen Orientierungen, die in den letzten 12 Monaten Gewalt in einer Partnerschaft erlebt haben.