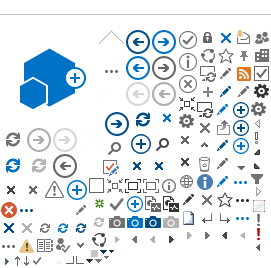Wie unterschiedlich Menschen der Krankheit COVID-19 begegnen, darüber spricht Verhaltenstherapeutin Prof. Dr. Anja Mehnert-Theuerkauf, Abteilungsleiterin für Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie am Universitätsklinikum Leipzig.
Und sie erläutert, welche Strategien es gegen die Angst vor der Krankheit gibt:

Wie gehen wir mit Krankheit um?
Menschen gehen sehr unterschiedlich mit Krankheiten um. Diese Unterschiede bestehen bereits in der Wahrnehmung der Krankheit – sehe ich diese beispielsweise als Herausforderung, der ich aktiv begegne oder ziehe ich mich eher passiv zurück? Ein aktiver Umgang mit einer Krankheit oder auch einer wenig greifbaren Bedrohung, wie sie die aktuelle Pandemie darstellt, bedeutet zum Beispiel sich zu informieren, um handlungsfähig zu bleiben und sich flexibel auf die neue Situation einzustellen, das heißt soziale Rollen, Regeln oder Strukturen an die neue Situation anzupassen. Konkret kann dies bedeuten, sich innerhalb der Familie oder Partnerschaft gemeinsam zu überlegen, wie der Alltag neu gestaltet werden kann: Wer übernimmt jetzt welche Dinge? Wie wollen wir miteinander umgehen? Auch Sorgen und Ängste zu kommunizieren und miteinander zu teilen, gehören dazu. Manche Menschen reagieren bei Krankheit aber auch mit sozialem Rückzug, möchten niemandem zur Last fallen oder zeigen aggressives Verhalten.
Wie wirkt sich die Ausbreitung des Corona-Virus gesellschaftlich aus?
Die Ausbreitung der Erkrankung und auch die Zunahme der Todesfälle schüren Ängste, die natürlich bei verschiedenen Bevölkerungsgruppen unterschiedlich ausgeprägt sind. So sind beispielsweise Menschen mit spezifischen Risiken und Krankheiten wie Krebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen besonders verunsichert. Zu den Ängsten vor der Erkrankung selbst kommen bei vielen Menschen existenzielle Sorgen durch die Folgen der Pandemie, vor allem in Bezug auf Einschränkungen der Freiheit und wirtschaftliche Folgen durch das Risiko einer weltweiten Rezession und die Zunahme von Kurzarbeit und Entlassungen. Insgesamt verhalten sich die meisten Menschen sehr besonnen. Dennoch nehmen soziale Spannungen und gesellschaftliche Stigmatisierung zu. Von bisherigen Epidemien weiß man, dass das Gesundheitsverhalten wie zum Beispiel hygienische Maßnahmen bei einer starken Bedrohung zunimmt, mit zunehmender Rückkehr des Alltags aber wieder nachlässt.
Was macht das mit uns Menschen, wenn wir zu Hause bleiben sollen? Sind ältere Menschen besonders betroffen?
Viele Menschen bedrückt dies und viele berichten über die Zunahme von Ängsten und depressiven Verstimmungen, aber auch Gefühlen von Langeweile und Frustration. Gerade ältere Menschen haben oft schon viele Krisen in ihrem Leben gemeistert und sind psychisch meist stabiler als jüngere Menschen. Dagegen sind sie häufig körperlich eingeschränkter, auf Unterstützung angewiesen und haben weniger soziale Kontakte. Auch wenn das Internet heute vielfältige Möglichkeiten bietet, sich zu vernetzen und am Leben zumindest virtuell teilzunehmen, zum Beispiel mit virtuellen Museumsbesuchen, Konzerten oder Reisedokumentationen, fällt es älteren Menschen oft schwerer als jungen Menschen, sich hier neuen Perspektiven zu öffnen oder sich zurechtzufinden.
Für alle, die zu Hause bleiben müssen, ist es wichtig, den Alltag so gut wie möglich zu strukturieren und positiv zu gestalten, zum Beispiel jeden Tag eine positive Aktivität wie eine sportliche Aktivität, etwas Leckeres kochen oder backen, gezielt einzuplanen. Wenn es nicht gleich auf Anhieb gut funktioniert, ist es hilfreich, geduldig mit sich und anderen zu sein und am nächsten Tag einen neuen Versuch zu starten. Soziale Kontakte, die uns gut tun, sollten möglichst beibehalten und gestärkt werden mit Telefonaten, sozialen Medien oder dem Internet. Aus psychologischer Sicht birgt die Corona-Krise wie jede Krise trotz Einschränkungen und Leiden auch Chancen, bisherige Dinge zu überdenken und/oder im Alltag, in der Familie oder im Beruf andere Prioritäten zu setzen.
Welche Strategien gibt es gegen die Angst vor der Krankheit?
Angst ist eine völlig angemessene Emotion auf eine Bedrohung, wie sie die COVID-19-Pandemie darstellt. Die Flut an bedrohlichen Nachrichten und Bildern aus der ganzen Welt kann ein zusätzlicher Stressor sein. Angst äußert sich typischerweise in Gedanken wie sich sorgen, grübeln, aber auch in körperlichen Symptomen zum Beispiel mit Herzrasen, Nervosität. Deshalb ist eine erste Strategie gegen die Angst, die individuell richtige Menge an Informationen zu finden, das heißt, sich aus vertrauenswürdigen Quellen wie zum Beispiel der Website des Robert Koch-Instituts zwar regelmäßig zu informieren, aber eben nicht rund um die Uhr. Ständig nach neuesten Nachrichten suchen und diese zu verfolgen, kann die Angst erhöhen und zuweilen sogar lähmend wirken. Auch kann es helfen, nur zu bestimmten Tageszeiten, am Morgen oder am Nachmittag Nachrichten zu schauen, aber nicht mehr in den späten Abendstunden, um den Schlaf nicht zu beeinträchtigen.
Viele Menschen erleben zusätzlich ein Gefühl der Ohnmacht, nicht wirklich etwas tun zu können und sich ausgeliefert zu fühlen. Hier helfen präventive Maßnahmen, die die Gesundheit und die Lebensqualität stärken, aber auch das Gefühl von Kontrolle erhöhen nach dem Motto „etwas zu tun ist besser, als nichts zu tun“. Dazu zählen Hygienemaßnahmen, Sport, Bewegung und Entspannung, regelmäßige gesunde Ernährung, maßvoller Alkoholgenuss, ausreichend Schlaf sowie der soziale Austausch in der Partnerschaft, Familie oder mit Freunden. Auch Ablenkung durch Arbeit oder Hobbies ist hilfreich. Zuweilen kann es nützlich sein kann, sich daran zu erinnern, dass Sorgen nichts ändern. Sind Ängste und Sorgen übermächtig und kaum kontrollierbar, ist es ratsam, professionelle psychologische Unterstützung zu suchen.